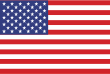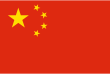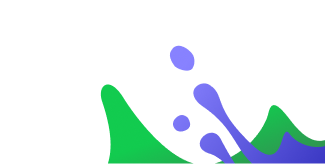Definition
Microservices Security oder Microservices-Sicherheit bezieht sich auf die Praktiken, Tools und Strategien, die zum Schutz verteilter Anwendungen eingesetzt werden, die auf einer Microservices-Architektur basieren. Im Gegensatz zu monolithischen Anwendungen, bei denen Sicherheitskontrollen zentralisiert sind, erfordert die Microservices-Architektur einen dezentralen Ansatz, bei dem jeder Service, seine Kommunikationskanäle und seine Abhängigkeiten abgesichert werden müssen.
Überblick
Microservices unterscheiden sich von traditionellen monolithischen Architekturen. Bei einem monolithischen Ansatz ist die Anwendungslogik zentralisiert, was die Entwicklung und Bereitstellung in den frühen Phasen vereinfacht. Wenn ein System jedoch schnell skaliert, sammelt eine monolithische Struktur häufig technische Schulden an, was Updates und Skalierung zunehmend komplexer macht.
Was sind Microservices?
Microservices bestehen aus kleineren, unabhängig bereitgestellten Services, die über APIs kommunizieren und gemeinsam eine vollständige Anwendung bilden. Die Microservices-Architektur bietet Entwicklern eine Reihe von Vorteilen:
Modularität: Jeder einzelne Service innerhalb einer Microservices-Struktur arbeitet unabhängig und erfüllt eine spezifische Funktion – gemäß dem „Single Responsibility Principle“. Die Aufgaben der einzelnen Services sind klar definiert, und keine zwei Services übernehmen dieselbe Funktion. Dadurch wird das Risiko größerer Systemausfälle reduziert, da einzelne Komponenten aktualisiert oder ersetzt werden können, ohne das Gesamtsystem zu beeinträchtigen.
Dezentrales Management: Die Datenhaltung in einer Microservices-Architektur ist flexibler als in einem monolithischen System. Jeder Service kann seine eigene Datenbank verwalten oder sich eine Datenbank mit anderen Services teilen. Dies verringert das Fehlerrisiko und ermöglicht mehr Autonomie und Flexibilität im Umgang mit Daten.
Skalierbarkeit: Microservices lassen sich gut mit containerisierten Infrastrukturen kombinieren, wodurch sie besonders portabel und skalierbar sind. Änderungen an einem einzelnen Service wirken sich nicht auf andere aus, sodass einzelne Services bei Bedarf unabhängig skaliert werden können, ohne das Gesamtsystem zu überlasten.
Agilität: Diese Architektur erlaubt es mehreren Teams, verschiedene Teile eines verteilten Systems parallel zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen – was die Agilität und Effizienz erhöht. Entwickler können außerdem für jeden Service die jeweils beste Technologie auswählen, um Performance und Flexibilität zu optimieren.
Was ist Microservices Security?
Die Flexibilität, die Microservices so leistungsfähig macht, vergrößert zugleich die Angriffsfläche – und damit auch das Risiko für unbefugten Zugriff, Datenlecks und Service-Ausfälle. Im Gegensatz zu monolithischen Anwendungen, bei denen Sicherheitskontrollen zentral implementiert werden können, basiert die Microservices-Architektur auf einem verteilten Sicherheitsmodell. Dadurch wird es komplexer, einzelne Komponenten sowie deren Interaktionen abzusichern.
Best Practices für Microservices Security
Die Absicherung einer Microservices-Architektur erfordert die Integration von Security-Maßnahmen in den Entwicklungsprozess – ohne dabei die Effizienz der Workflows zu beeinträchtigen. Hier sind einige Best Practices, die dabei helfen:
Sichere Coding- und Deployment-Praktiken umsetzen
Die Einhaltung sicherer Programmierstandards ist entscheidend, um Schwachstellen wie Injection-Angriffe, unsichere Deserialisierung oder die Preisgabe sensibler Daten zu vermeiden. Dabei sollte sowohl Static Application Security Testing (SAST) als auch Dynamic Application Security Testing (DAST) in den Entwicklungszyklus integriert werden.
- SAST analysiert den Quellcode während der Entwicklungsphase auf Sicherheitslücken.
- DAST testet laufende Anwendungen auf Schwachstellen zur Laufzeit.
Ein zentraler Aspekt sicheren Codings in Microservices ist das korrekte Management von Secrets. Werden sensible Informationen wie API-Schlüssel oder Zugangsdaten unsachgemäß gespeichert – etwa direkt im Quellcode –, stellt das ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, selbst in privaten Repositories.
Stattdessen sollten Secrets in Umgebungsvariablen oder in speziell dafür vorgesehenen Secrets-Management-Tools wie HashiCorp Vault abgelegt werden. Diese ermöglichen eine sichere, zentralisierte Verwaltung und schützen sensible Daten vor unbefugtem Zugriff – auch über mehrere Microservices hinweg.
Die Absicherung von Containern ist entscheidend für den Schutz von Microservices in Produktionsumgebungen und stellt sicher, dass Anwendungen in einer kontrollierten und widerstandsfähigen Umgebung ausgeführt werden. Das Image-Scanning sollte in CI/CD-Pipelines integriert werden, um Schwachstellen vor der Bereitstellung zu erkennen, während das Laufzeit-Sicherheitsmonitoring dabei hilft, anomales Verhalten in aktiven Containern zu identifizieren. Container sollten nach dem Prinzip der minimalen Rechte betrieben werden – mit nur den Berechtigungen, die für ihre Funktion erforderlich sind – und isoliert werden, um unbefugten Zugriff zwischen Diensten zu verhindern. Die Implementierung von Netzwerkrichtlinien, unveränderlicher Infrastruktur und automatisierten Sicherheitsupdates reduziert zusätzliche Risiken und stellt sicher, dass Microservices auch gegenüber neuen Bedrohungen geschützt bleiben.
Sichere Kommunikationskanäle zwischen Microservices und externen Diensten
Der Schutz von Daten während der Übertragung zwischen Microservices ist von entscheidender Bedeutung. Die Implementierung von Transport Layer Security (TLS) gewährleistet eine verschlüsselte Kommunikation und schützt so vor Abhören und Manipulation. Für ein höheres Sicherheitsniveau kann Mutual TLS (mTLS) eingesetzt werden, bei dem sich sowohl Client als auch Server gegenseitig per Zertifikat authentifizieren. Dadurch wird unbefugter Zugriff sowie Man-in-the-Middle-Angriffen wirksam vorgebeugt.
Darüber hinaus sollten interne Microservices nicht direkt über das öffentliche Internet erreichbar sein. API-Gateways fungieren als Vermittler, die Anfragen sicher verarbeiten und gleichzeitig Authentifizierungs- sowie Ratenbegrenzungsrichtlinien durchsetzen, um Missbrauch zu verhindern.
API-Gateways helfen außerdem, Missbrauch und Dienstunterbrechungen durch Ratenbegrenzung und Drosselung zu vermeiden. Indem sie die Anzahl der Anfragen pro Client oder IP-Adresse begrenzen, tragen sie zur Abwehr von Denial-of-Service-Angriffen (DoS) bei und verhindern, dass einzelne Services überlastet werden. Dieses Vorgehen sorgt für eine faire Ressourcennutzung, stabilisiert das System und schützt die Performance der gesamten Microservices-Architektur.
Sichere Kommunikationskanäle zwischen Microservices und externen Diensten
Der Schutz von Daten, die zwischen Microservices übertragen werden, ist essenziell. Durch den Einsatz von Transport Layer Security (TLS) wird die Kommunikation verschlüsselt, wodurch Abhören und Manipulation verhindert werden. Für ein noch höheres Sicherheitsniveau kann Mutual TLS (mTLS) eingesetzt werden. Dabei authentifizieren sich sowohl Client als auch Server gegenseitig mithilfe von Zertifikaten – ein wirksamer Schutz gegen unbefugten Zugriff und Man-in-the-Middle-Angriffe.
Zudem sollten interne Microservices nicht direkt dem öffentlichen Internet ausgesetzt werden. API-Gateways übernehmen hier eine zentrale Rolle: Sie fungieren als sichere Vermittler, die eingehende Anfragen verarbeiten und gleichzeitig Authentifizierungsmechanismen sowie Richtlinien zur Begrenzung von Anfragen (Rate Limiting) durchsetzen.
Darüber hinaus tragen API-Gateways zur Vermeidung von Missbrauch und zur Sicherstellung der Dienstverfügbarkeit bei, indem sie durch Ratenbegrenzung und Drosselung die Anzahl der Anfragen pro Client oder IP-Adresse einschränken. Dies hilft, Denial-of-Service-Angriffe (DoS) abzuwehren und verhindert, dass einzelne Services überlastet werden. Auf diese Weise wird eine faire Ressourcenverteilung gefördert, die Systemstabilität gewahrt und die Gesamtleistung der Microservices-Architektur geschützt.
Authentifizierung und Autorisierung in verteilten Systemen verwalten
Eine der größten Herausforderungen bei der Absicherung von Microservices besteht in der Verwaltung von Authentifizierung und Autorisierung. In monolithischen Systemen übernimmt in der Regel ein zentraler Authentifizierungsdienst diese Aufgabe. In einer Microservices-Architektur hingegen müssen oft mehrere Services Identitäten verifizieren, weshalb eine zentrale Authentifizierungslösung unerlässlich ist.
Durch den Einsatz von OAuth 2.0 zur Autorisierung und OpenID Connect (OIDC) zur Authentifizierung können Unternehmen ein Single-Sign-On (SSO)-Verfahren etablieren, bei dem sich Nutzer einmalig anmelden und anschließend sichere JSON Web Tokens (JWTs) erhalten. Diese Tokens ermöglichen es einzelnen Microservices, die Authentifizierung zu prüfen, ohne wiederholt Zugangsdaten abfragen zu müssen – ein entscheidender Vorteil in verteilten Systemen mit hoher Last.
API-Gateways setzen Authentifizierungs- und Zugriffspolicies bereits an den Einstiegspunkten durch, indem sie JWTs validieren und authentifizierte Anfragen gezielt an die zuständigen Microservices weiterleiten. Durch die Implementierung von rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) oder attributbasierter Zugriffskontrolle (ABAC) sowie benutzerdefinierten Zugriffspolicies können Organisationen sicherstellen, dass Nutzer und Dienste nur auf jene Ressourcen und Funktionen zugreifen dürfen, die ihrer Rolle oder ihren Attributen entsprechen. Dies minimiert unbefugten Zugriff und stärkt die Gesamtsicherheit durch eine konsistente Durchsetzung von Berechtigungen über alle Microservices hinweg.
Kontinuierliches Security Testing und Monitoring
Sicherheit in einer Microservices-Architektur erfordert kontinuierliches Testen und eine Überwachung in Echtzeit, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, bevor sie ausgenutzt werden können. Klassische Sicherheitstechniken wie Penetrationstests und Schwachstellenscans lassen sich an die verteilte Struktur von Microservices anpassen. Wird automatisiertes Security Testing in CI/CD-Pipelines integriert, lassen sich Schwachstellen bereits früh im Entwicklungszyklus identifizieren und beheben – ein wesentlicher Beitrag zur Risikominimierung vor dem Deployment.
Neben proaktivem Testen spielt auch das Monitoring und Logging eine zentrale Rolle bei der Erkennung potenzieller Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit. Zentralisierte Logging- und Monitoring-Lösungen verschaffen umfassende Transparenz über sämtliche Microservices hinweg und ermöglichen es Teams, anormales Verhalten zu verfolgen, potenzielle Sicherheitsverletzungen zu erkennen und rasch auf Vorfälle zu reagieren. Die Einführung von Mechanismen zur Bedrohungserkennung – darunter Intrusion Detection Systems (IDS), Security Event Monitoring und automatisierte Incident-Response-Prozesse – stärkt die Fähigkeit eines Unternehmens, Angriffe frühzeitig einzugrenzen und wirksam zu bekämpfen.
Herausforderungen bei der Microservices Security
Auch wenn die Einhaltung von Best Practices einen wichtigen Beitrag zur Absicherung von Microservices leistet, ist die Umsetzung in der Praxis mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Im Folgenden sind einige zentrale Aspekte aufgeführt, die besondere Aufmerksamkeit erfordern:
Sicherheitsmanagement über mehrere Microservices hinweg.
In einer Microservices-Architektur arbeitet jeder Service unabhängig – oft mit eigener Codebasis, Laufzeitumgebung und Datenbank. Diese Unabhängigkeit erschwert die einheitliche Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen über alle Services hinweg. Um sicherzustellen, dass jeder Microservice den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entspricht, sind gezielte Koordination und zentrale Steuerung erforderlich. Fehlt ein übergreifendes Sicherheitsframework, besteht das Risiko inkonsistenter Sicherheitspraktiken – ein Einfallstor für potenzielle Schwachstellen
Einheitlichkeit und Compliance bei Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten.
Die Einhaltung einheitlicher Sicherheitsstandards ist besonders anspruchsvoll, wenn Microservices auf unterschiedlichen Technologien und Frameworks basieren. Die Durchsetzung konsistenter Sicherheitsprotokolle wird dadurch erschwert. Um die Anforderungen von Branchenstandards und gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, ist ein umfassender Sicherheitsansatz notwendig: Dazu gehören regelmäßige Audits, standardisierte Sicherheitsrichtlinien sowie ein kontinuierliches Monitoring, um sicherzustellen, dass alle Microservices die definierten Sicherheitskriterien erfüllen.
Sicherheitsvorfälle in Echtzeit überwachen und erkennen
Die verteilte Struktur von Microservices kann die Sichtbarkeit im Gesamtsystem einschränken und erschwert so die schnelle Erkennung von Sicherheitsvorfällen. Eine effektive Überwachung aller Services erfordert daher eine robuste Logging- und Monitoring-Infrastruktur. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Logs aus verschiedenen Microservices effizient zu aggregieren, zu analysieren und daraus relevante Sicherheitsinformationen abzuleiten. Fortschrittliche Monitoring-Lösungen sowie zentralisierte Logging-Systeme sind entscheidend, um ein umfassendes Bild der Sicherheitslage zu erhalten und Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren.
Zukünftige Trends und Innovationen in der Microservices-Sicherheit
Mit dem weiteren Wachstum und der zunehmenden Komplexität von Microservices-Architekturen stoßen traditionelle Sicherheitsmaßnahmen an ihre Grenzen. Um modernen Bedrohungen wirksam zu begegnen, werden neue Sicherheitsansätze entwickelt, die stärker auf Automatisierung, intelligente Erkennung und adaptive Schutzmechanismen setzen.
Neue Technologien und Ansätze für eine verbesserte Microservices-Sicherheit
Die Zukunft der Microservices-Sicherheit wird geprägt sein von Automatisierung, intelligenter Bedrohungserkennung und adaptiven Sicherheitsmodellen. Mit der zunehmenden Komplexität moderner Microservices-Architekturen stoßen traditionelle, perimeterbasierte Sicherheitsansätze an ihre Grenzen. Stattdessen vollziehen viele Unternehmen den Wechsel zu Zero Trust Security – einem Sicherheitsmodell, das davon ausgeht, dass kein Nutzer, keine Anfrage und kein Service von vornherein vertrauenswürdig ist. Jeder Zugriff muss kontinuierlich verifiziert werden, bevor er gewährt wird.
Die Rolle von Automatisierung und Machine Learning in der Absicherung von Microservices
KI-gesteuerte Sicherheitsautomatisierung wird eine zentrale Rolle bei der Identifizierung von Schwachstellen, der Erkennung von Anomalien und der Reaktion auf Bedrohungen in Echtzeit spielen. Machine-Learning-Algorithmen verbessern die Verhaltensanalyse und ermöglichen es Sicherheitssystemen, Angriffe vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie eskalieren.
Automatisierte Richtliniendurchsetzung und Security Orchestration gewährleisten, dass Sicherheitskonfigurationen konsistent über verteilte Umgebungen hinweg angewendet werden – wodurch manuelle Fehler und Fehlkonfigurationen deutlich reduziert werden.
Auch die API-Sicherheit wird sich weiterentwickeln – mit einer zunehmenden Verbreitung von automatisierter API-Erkennung, KI-gestützter Bedrohungsanalyse und fortschrittlichen Ratenbegrenzungsmechanismen. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz vor API-Missbrauch, Credential Stuffing und DDoS-Angriffen.
Integrierte Sicherheit in der Software Supply Chain
Die Absicherung der Software-Lieferkette wird zunehmend zur Priorität für Unternehmen. Immer mehr Organisationen setzen auf integrierte Sicherheitsscans, Herkunftsnachweise (Provenance Tracking) und kryptografische Signaturen, um die Integrität einzelner Microservices-Komponenten zuverlässig zu überprüfen.
Durch die Kombination aus KI-gesteuerter Automatisierung, Zero-Trust-Frameworks und kontinuierlichem Monitoring lassen sich Microservices-Umgebungen umfassend absichern – ohne dabei Agilität oder Performance einzubüßen.
Integrierte Sicherheit in der Software Supply Chain
Darüber hinaus werden sichere Software-Lieferketten immer wichtiger. Immer mehr Unternehmen nutzen integriertes Sicherheitsscanning, Provenance-Tracking und kryptografische Signaturen, um die Integrität ihrer Microservices-Komponenten zu überprüfen.
Durch die Kombination von KI-gesteuerter Automatisierung, Zero-Trust-Frameworks und kontinuierlicher Überwachung können Unternehmen Microservices-Umgebungen absichern, ohne die Agilität oder Leistung zu beeinträchtigen.
Microservices-Sicherheit ist keine Einheitslösung – sie erfordert eine Kombination aus Best Practices und ständiger Überwachung. Die Sicherheitslösungen von JFrog bieten einen Ende-zu-Ende-Schutz und stellen sicher, dass Software-Artefakte, containerisierte Anwendungen und laufende Dienste sicher, konform und widerstandsfähig gegenüber sich entwickelnden Bedrohungen bleiben.
Durch die Integration von Sicherheit in jede Phase des Lebenszyklus von Microservices können Unternehmen mit Zuversicht Innovationen schaffen, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Sichern Sie Ihre Microservices mit JFrog
JFrog bietet umfassende Sicherheitslösungen zum Schutz von Software-Artefakten, zur Erkennung von Schwachstellen und zur Durchsetzung von Compliance in Microservices-Architekturen. Durch die Integration von Sicherheit direkt in den Entwicklungslebenszyklus hilft JFrog Organisationen, von Grund auf sichere Microservices aufzubauen.
JFrog Advanced Security umfasst die gesamte Palette an Sicherheitswerkzeugen, die Open-Source-Software (OSS) Kuration, Software Composition Analysis (SCA), Software Bill of Materials (SBOM), Container Security, Kontextanalyse, Secrets Detection, Infrastructure as Code (IaC) Security, Misconfigurations, Static Application Security Testing (SAST) und mehr abdecken. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem virtuellen Rundgang oder bei einem persönlichen Demo-Termin.