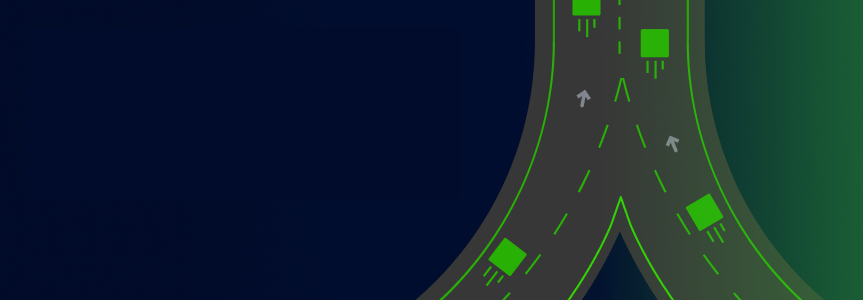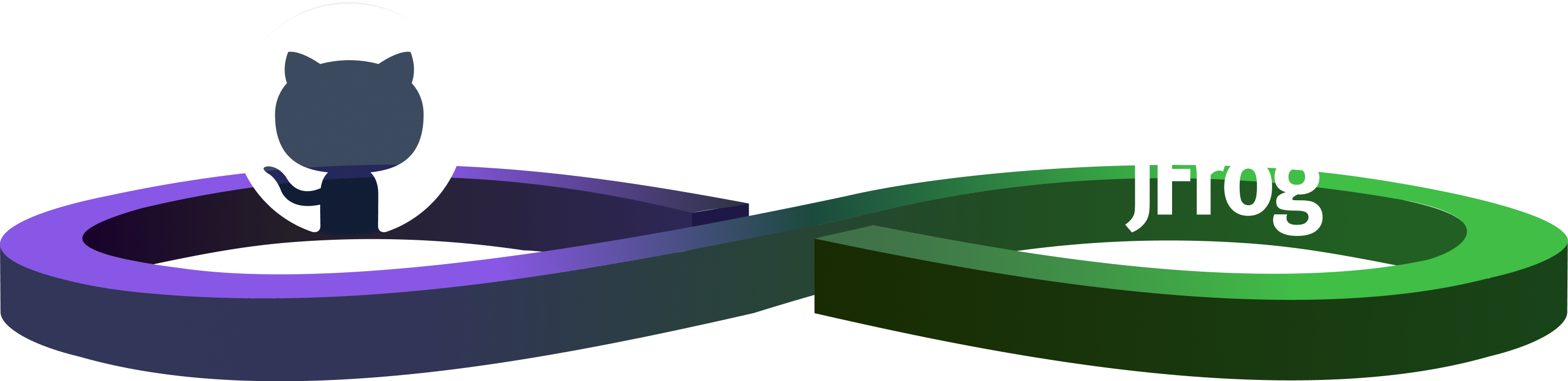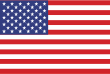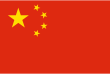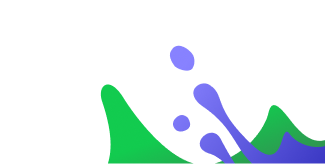Silos aufbrechen: DevOps und MLOps zu einer einheitlichen Software-Lieferkette vereinen – Teil 3
Herausforderungen und Lösungen bei der Zusammenführung von DevOps & MLOps
Die Synergie zwischen DevOps und MLOps ist heute wichtiger denn je. Doch die Verschmelzung dieser beiden Paradigmen zu einer kohärenten Software Supply Chain bringt eine Reihe spezifischer Herausforderungen mit sich – von der komplexen Verwaltung von Modellabhängigkeiten bis zur Anpassung klassischer CI/CD-Tools an moderne Machine-Learning-Workflows. Kein Wunder also, dass sich viele Teams von diesem Integrationsprozess überfordert fühlen.
In dieser Artikelserie zeigen wir, wie die Kombination klassischer Softwareentwicklungsprozesse mit Machine-Learning-Praktiken Unternehmen dazu befähigt, sich im Rennen um Künstliche Intelligenz (KI) einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
- Teil 1 beleuchtete die Herausforderungen getrennter DevOps- und MLOps-Pipelines und machte deutlich, warum eine Integration notwendig ist.
- Teil 2 stellte die Vorteile und Chancen einer vereinten Software-Lieferkette für Machine Learning und klassische Softwareentwicklung in den Mittelpunkt.
Im letzten Teil dieser Serie widmen wir uns nun den konkreten Hürden, die im Integrationsprozess auftreten – etwa bei Datenabhängigkeiten, der Versionierung oder im Bereich Sicherheit – und stellen Best Practices vor, mit denen sich Abläufe gezielt optimieren lassen.
Lesen Sie weiter, um Strategien zu entdecken, wie Sie eine robuste und effiziente Software Supply Chain aufbauen, die sowohl den Anforderungen der Softwareentwicklung als auch dem Deployment von ML-Modellen gerecht wird.
Komplexität der Integration
Die Zusammenführung von DevOps und MLOps zu einer einheitlichen Software-Lieferkette bringt eine Reihe technischer Herausforderungen mit sich – insbesondere aufgrund der Unterschiede zwischen klassischer Software und Machine-Learning-Modellen. Die größten Herausforderungen betreffen die Verwaltung von Abhängigkeiten, die Anpassung bestehender CI/CD-Tools an ML-spezifische Anforderungen und die Sicherstellung von Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus von Software und Modellen hinweg.
1. Verwaltung von Abhängigkeiten
ML-Modelle bringen spezifische Abhängigkeiten mit, die die Integration erschweren. Im Gegensatz zu klassischer Software benötigen ML-Modelle bestimmte Datensätze, Feature-Engineering-Pipelines und Framework- oder Bibliotheksversionen. Die Verwaltung dieser Abhängigkeiten über verschiedene Umgebungen hinweg – Entwicklung, Test, Produktion – ist herausfordernd.
- Datenabhängigkeiten: Der Trainingsprozess von ML-Modellen erfordert konsistente und qualitativ hochwertige Daten. Wird ein Modell mit unterschiedlichen Datenversionen trainiert, kann dies zu schwer nachvollziehbaren Performance-Problemen führen. Daher ist es essentiell, die richtige Datenversion zu verwenden und die Datenherkunft (Data Lineage) präzise zu dokumentieren. Ohne sauberes Abhängigkeitsmanagement leidet die Reproduzierbarkeit und Modellgenauigkeit erheblich.
- Framework- und Bibliotheksversionen: ML-Modelle basieren auf Frameworks wie TensorFlow, PyTorch oder anderen, die jeweils eigene Versionen und Abhängigkeiten mitbringen. Die Kompatibilität zwischen Frameworks und der restlichen Softwareumgebung ist entscheidend für eine stabile Integration und ein erfolgreiches Deployment. Versionsinkonsistenzen – etwa zwischen Trainings- und Produktionsumgebung – können dazu führen, dass Modelle nicht mehr ausführbar sind oder unerwartetes Verhalten zeigen.
2. Anpassung bestehender CI/CD-Tools
Klassische CI/CD-Tools wie Jenkins, GitLab CI oder CircleCI wurden primär für die Verwaltung von Softwarecode entwickelt – nicht für Machine-Learning-Modelle. Um diese Tools für MLOps nutzbar zu machen, sind gezielte Anpassungen erforderlich:
- Komplexe Pipelines: ML-Pipelines bestehen aus mehreren, für klassische CI/CD-Prozesse untypischen Phasen: Datenvalidierung, Feature Engineering, Modelltraining, Hyperparameter-Tuning und Evaluation. Diese zusätzlichen Schritte müssen in bestehende CI/CD-Workflows integriert werden – inklusive Unterstützung für datengetriebene Abläufe und nicht-deterministische Trainingsprozesse. Dazu bedarf es individueller Anpassungen der Pipeline-Logik, um die Komplexität von ML-Prozessen abzubilden.
- Experiment-Tracking: Im Gegensatz zu Softwarecode erfordert Modelltraining die Durchführung vieler Experimente, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Tools wie MLflow oder Weights & Biases unterstützen das Tracking dieser Experimente – doch ihre Einbindung in klassische CI/CD-Umgebungen ist technisch anspruchsvoll. Nur wenn Experimente, Metriken und Ergebnisse korrekt versioniert und protokolliert werden, lässt sich der ML-Lifecycle zuverlässig steuern.
3. Umgang mit Sicherheitsaspekten bei Modellen
Die Einbindung von ML-Modellen in eine Software-Lieferkette bringt neue Sicherheitsanforderungen mit sich, die über klassische DevSecOps-Maßnahmen hinausgehen:
- Compliance, Governance und Datensicherheit: Daten, die zum Modelltraining verwendet werden, müssen besonders sorgfältig behandelt werden – insbesondere wenn sie personenbezogene oder sensible Informationen enthalten. Das erfordert Maßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und richtlinienkonforme Datenverarbeitung über den gesamten Speicher- und Verarbeitungsprozess hinweg, um Datenlecks und unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Modell-Sicherheitslücken: ML-Modelle sind anfällig für spezifische Bedrohungen wie Adversarial Attacks – Angriffe, bei denen manipulierte Eingabedaten gezielt zu fehlerhaften Modellvorhersagen führen. Solche Bedrohungen erfordern neue Formen von Sicherheitstests, die in die CI/CD-Pipeline integriert werden müssen.
Bevor Modelle in Produktion gehen, sollten sie auf derartige Schwachstellen geprüft werden, um robuste und sichere Deployments zu gewährleisten.
Bewährte Praktiken für die Integration der Software-Lieferkette
Um die Herausforderungen bei der Verschmelzung von DevOps und MLOps zu bewältigen, empfiehlt sich die Einführung bewährter Praktiken. Sie erleichtern die Integration in eine einheitliche Software Supply Chain und sorgen für effiziente, zuverlässige und sichere Workflows.
1. Standardisierte Toolsets teamübergreifend einsetzen
Standardisierte Toolsets sind entscheidend, um Konsistenz zu gewährleisten und Kompatibilitätsprobleme bei der Integration von DevOps und MLOps zu vermeiden. Ziehen Sie die folgenden Punkte als Ausgangsbasis in Betracht:
- Zentrale Artefaktverwaltung: Verwenden Sie ein zentrales Artefakt-Repository (z. B. JFrog Artifactory), um Code, Binärdateien und ML-Modelle zu speichern. So werden alle Artefakte einheitlich behandelt, inklusive Versionierung, Freigabeprozessen und Sicherheitsprüfungen. Gleichzeitig behalten Sie die Kontrolle über Abhängigkeiten, da alle Komponenten – einschließlich Datensätze und Modelle – konsistent nachverfolgt werden.
- Pipeline-Orchestrierungstools: Tools wie Kubeflow oder Jenkins X unterstützen die Verwaltung komplexer Pipelines, die sowohl Software- als auch ML-Workflows umfassen. Sie bieten Plugins und Integrationen für Datenvorverarbeitung, Modelltraining und Deployment – und stellen sicher, dass alle Teile der CI/CD-Pipeline kohärent orchestriert werden.
2. Zentrale Feature Stores nutzen
Ein zentraler Feature-Store ist ein wesentliches Element zur Verwaltung von Datenabhängigkeiten und zur Förderung von Konsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg. Zu den zentralen Vorteilen eines zentralisierten Feature-Stores gehören:
- Wiederverwendbarkeit von Features: Feature-Stores ermöglichen es Teams, Features zentral zu speichern und für verschiedene Modelle und Experimente wiederzuverwenden. Dadurch werden Redundanzen vermieden und eine konsistente Datenbasis geschaffen. Anstatt Features für jedes Modell neu zu definieren, können Data Scientists durch Feature Stores auf bestehende Features zugreifen, was die Effizienz erhöht und das Risiko von Inkonsistenzen verringert.
- Versionierung und Nachvollziehbarkeit: Features in einem zentralen Feature-Store lassen sich – ähnlich wie Code und Modelle – versionieren. So wird sichergestellt, dass beim Training und beim Serving jeweils die korrekte Version eines Features verwendet wird. Das unterstützt die Konsistenz über den gesamten ML-Lifecycle hinweg und ermöglicht eine vollständige Nachverfolgbarkeit, inklusive Reproduzierbarkeit von Experimenten und der Rückverfolgung der für jedes Modell genutzten Daten.
3. Modulare und erweiterbare CI/CD-Pipelines einsetzen
Entwerfen Sie CI/CD-Pipelines modular und so, dass sie ML-spezifische Aufgaben neben klassischen Software-Workflows verarbeiten können. In der Praxis bedeutet das:
- Modularisierung der Pipeline: Strukturieren Sie die CI/CD-Pipeline modular, um ML-spezifische Phasen wie Datenvalidierung, Training und Modellauswertung zu integrieren. Tools wie GitLab CI oder Jenkins lassen sich mit benutzerdefinierten Skripten oder Plugins erweitern, um diese Aufgaben abzubilden. So bleibt die Pipeline flexibel und kann sich leichter an veränderte Anforderungen anpassen.
- Integration von Experimenten: Binden Sie Tools zur Experimentverfolgung direkt in die CI/CD-Pipeline ein, um das Logging, die Versionierung und die Analyse von Experimenten zu automatisieren. Diese Integration sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Modellleistung über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg – und erleichtert es, die leistungsstärksten Modelle für den produktiven Einsatz zu identifizieren.
4. Sicherheit und Compliance von Anfang an berücksichtigen
Integrieren Sie Sicherheits- und Compliance-Prüfungen in die Software-Lieferkette, um sicherzustellen, dass ML-Modelle über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg robust, regelkonform und sicher bleiben. Folgende Ansätze helfen Ihnen dabei:
- DevSecOps für Modelle: Erweitern Sie DevSecOps-Praktiken gezielt auf ML-Modelle, sodass diese vor dem Deployment Sicherheits-Scans und Schwachstellenanalysen durchlaufen. Setzen Sie Tools ein, die das Verhalten von Modellen analysieren und Schwachstellen für Angreifer erkennen können – so erhöhen Sie die Resilienz Ihrer Modelle gegenüber Angriffen.
- Governance für Daten und Modelle: Sorgen Sie für Regelkonformität, indem Sie Governance-Protokolle für die Datennutzung und das Modell-Deployment etablieren. Dazu gehören Zugriffsrechte, Verschlüsselung und Audit-Trails sowohl für die Trainingsdaten als auch für Modell-Artefakte. Legen Sie Standards für Erklärbarkeit (Explainability) fest, um sicherzustellen, dass Modelle geprüft, verstanden und im Hinblick auf regulatorische Anforderungen validiert werden können.
5. Zusammenarbeit fördern und Teams vernetzen
Um die Kluft zwischen Data Science, Engineering und Betriebsteams zu überbrücken, ist eine enge Zusammenarbeit entscheidend. Dies gelingt durch eine einheitliche Entwicklungsumgebung:
- Einheitliche Entwicklungsumgebung: Nutzen Sie eine gemeinsame Umgebung, in der alle Teams mit denselben Tools, Repositories und Monitoring-Systemen arbeiten. Ein solcher gemeinsamer Rahmen reduziert Reibungsverluste, verbessert die Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass alle Beteiligten nach denselben Prozessen und Standards arbeiten.
Fazit
Die Integration von DevOps und MLOps ist komplex, da sie besondere Abhängigkeiten, Toolanpassungen und neue Sicherheitsanforderungen im Umgang mit ML-Modellen erfordert. Mit standardisierten Tools, zentralisiertem Feature-Management, modular aufgebauten CI/CD-Pipelines und integrierten Security- und Compliance-Maßnahmen lassen sich diese Herausforderungen meistern.
Die Umsetzung dieser Best Practices ermöglicht eine nahtlose, effiziente und sichere Software-Lieferkette, die klassische Softwarekomponenten ebenso wie Machine-Learning-Modelle umfasst – für schnellere Auslieferung, gleichbleibende Qualität und bessere Zusammenarbeit über alle Teams hinweg.