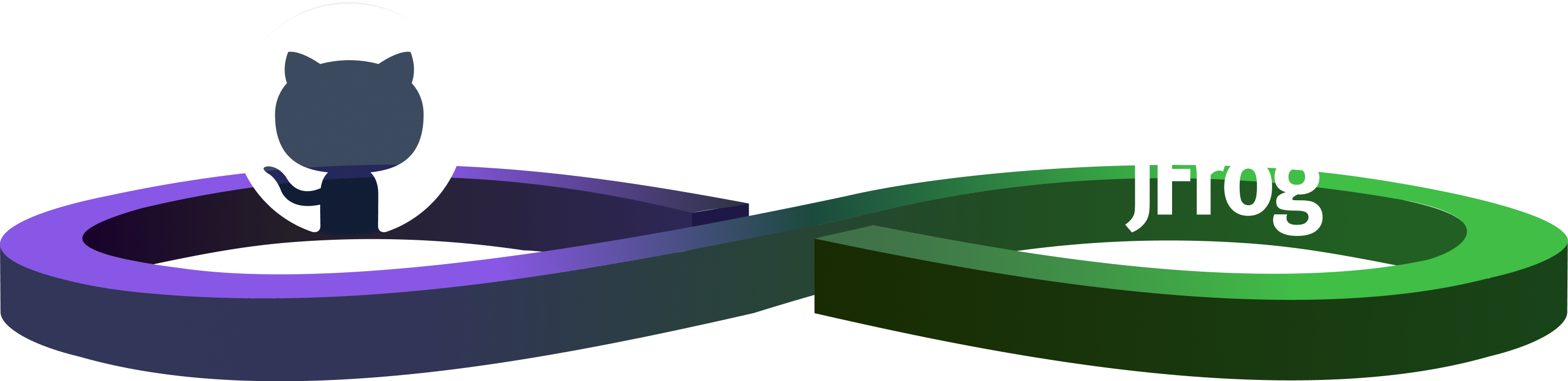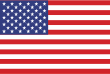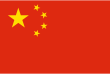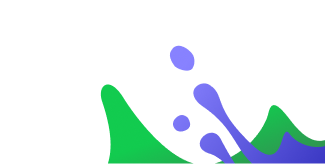Silos aufbrechen: DevOps und MLOps zu einer einheitlichen Software-Lieferkette vereinen – Teil 2
Vorteile und Chancen einer einheitlichen Software Supply Chain
Silos aufbrechen: DevOps und MLOps zu einer einheitlichen Software-Lieferkette vereinen – Teil 2
In dieser Blogserie beleuchten wir die Bedeutung der Verschmelzung bewährter DevOps-Praktiken mit MLOps, um bestehende Lücken zu schließen, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken und datengestützte Entscheidungsfindung zu fördern.
Teil 1 behandelte die Herausforderungen getrennter DevOps– und MLOps-Pipelines und zeigte auf, warum eine Integration notwendig ist.
Im zweiten Teil dieser dreiteiligen Serie gehen wir nun auf die Vorteile und Chancen einer vereinten Software Supply Chain ein, die sowohl Machine Learning (ML) als auch traditionelle Softwareentwicklung umfasst – und werfen einen genaueren Blick auf die technische Umsetzung dieser Integration.
Vorteile und Chancen einer einheitlichen Software-Lieferkette
Durch die Vereinheitlichung Ihrer Software-Lieferkette profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen – darunter eine höhere operative Effizienz, schnellere Release-Zyklen und eine verbesserte teamübergreifende Zusammenarbeit. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie sich diese Vorteile in der Praxis zeigen, wenn eine gemeinsame Software-Lieferkette für MLOps und DevOps umgesetzt wird.
Operative Effizienz: Weniger Doppelstrukturen bei Infrastruktur, Prozessen und Ressourcen
Die Zusammenführung von DevOps und MLOps in eine gemeinsame Software-Lieferkette schafft erhebliche operative Effizienzgewinne, da Doppelstrukturen bei Infrastruktur, Prozessen und Ressourcen abgebaut werden.
Werden DevOps und MLOps getrennt betrieben, benötigt jede Pipeline in der Regel ihre eigene Infrastruktur – etwa Build-Server, Speichersysteme oder Orchestrierungs-Tools. Das führt zu doppeltem Aufwand und erhöhten Kosten, da zwei separate Umgebungen für Software und ML-Modelle verwaltet werden müssen.
Eine einheitliche Pipeline reduziert diese Redundanzen und ermöglicht eine konsolidierte Nutzung bestehender Ressourcen – für schlankere Prozesse, geringere Betriebskosten und bessere Skalierbarkeit.
Durch die Vereinheitlichung dieser Pipelines können Unternehmen:
- Infrastruktur zentralisieren: Anstatt separate Umgebungen für Software-Artefakte und ML-Modelle zu pflegen, kann ein gemeinsamer Infrastruktursatz – etwa CI/CD-Tools, Kubernetes-Cluster und Artefakt-Repositories – beide Bereiche abdecken.
Diese Konsolidierung senkt den Verwaltungsaufwand für doppelte Systeme und reduziert Kosten für Wartung, Skalierung und Monitoring. - Prozesse standardisieren: Auch redundante Prozesse wie Versionierung, Testing und Deployment werden durch die Zusammenführung überflüssig.
Werden ML-Modelle als integraler Bestandteil des Software-Ökosystems behandelt, können Validierung, Containerisierung und Bereitstellung über einheitliche Workflows erfolgen. Diese Standardisierung reduziert Inkonsistenzen, vereinfacht operative Aufgaben und schafft einen vorhersehbaren, verlässlichen Ablauf für alle Beteiligten. - Ressourcennutzung optimieren: Rechenintensive Aufgaben wie ML-Training oder das Ausführen von CI/CD-Pipelines lassen sich effizienter gestalten, wenn gemeinsame Rechenumgebungen genutzt werden.
Teams benötigen keine dedizierte Infrastruktur mehr nur für das Modelltraining, sondern können dieselben Ressourcen wie für Software-Builds verwenden. Das führt zu einer optimalen Auslastung der Rechenkapazitäten und vermeidet Leerlauf oder ungenutzte Ressourcen.
Die Integration von DevOps und MLOps steigert die operative Effizienz, senkt Infrastrukturkosten, automatisiert wiederkehrende Aufgaben und schafft eine agile, skalierbare Entwicklungsumgebung für Software und Machine Learning gleichermaßen.
Schnellere Release-Zyklen: Kürzere Markteinführungszeit für Code und Modelle
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Integration von DevOps und MLOps ist die Beschleunigung der Release-Zyklen – sowohl für klassischen Softwarecode als auch für ML-Modelle. Wird CI/CD auf Machine Learning ausgeweitet, verbessert sich die Markteinführungszeit erheblich. Unternehmen können neue Features, Updates und Modelle schneller und kontinuierlich veröffentlichen.
- Vereinheitlichtes CI/CD für alle Artefakte: Durch die Integration von Modellen als Artefakte in die CI/CD-Pipeline lässt sich der gesamte Lebenszyklus automatisieren – von der Code-Integration und dem Testing bis hin zum Modelltraining und Deployment.
Sowohl Software als auch ML-Modelle durchlaufen dann dieselbe Pipeline, was gleichzeitige Releases ermöglicht – ohne separate Deployment-Prozesse oder Wartezeiten.
- Weniger manuelle Eingriffe: Traditionell erfordert die Bereitstellung von ML-Modellen viele manuelle Schritte – etwa zur Validierung, Paketierung und Auslieferung.
Werden diese Schritte in die CI/CD-Pipeline integriert und automatisiert, sinkt der manuelle Aufwand deutlich. Modelle werden kontinuierlich integriert, validiert und bereitgestellt – genau wie herkömmliche Software.
Das beschleunigt nicht nur Releases, sondern sorgt auch für Konsistenz und weniger Fehleranfälligkeit.
- Schnellere Reaktion auf Veränderungen: Sind DevOps und MLOps vereint, können Teams schneller auf Änderungen im Code oder in den Daten reagieren.
Beispiel: Wird ein Bug entdeckt oder verschlechtert sich die Modellleistung aufgrund von Data Drift, kann die einheitliche Pipeline automatisch Updates anstoßen – mit minimaler Downtime und stabiler Systemperformance.
Diese Fähigkeit zur schnellen Iteration ist in dynamischen Umgebungen entscheidend, in denen sich sowohl Software als auch ML-Modelle ständig weiterentwickeln müssen.
Durch beschleunigte Release-Zyklen ermöglicht ein integrierter Ansatz, den Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten – sei es in Form neuer Softwarefunktionen oder verbesserter ML-Modelle. So steigern Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit auf dem Markt.
Verbesserte Zusammenarbeit: Silos zwischen Teams auflösen
Einer der größten Vorteile der Integration von DevOps und MLOps ist die gestärkte Zusammenarbeit zwischen Engineering-, Data-Science- und Operations-Teams. Traditionell arbeiten diese Gruppen in Silos – mit eigenen Tools, Prozessen und Zielsetzungen. Das führt zu Ineffizienzen, Kommunikationslücken und Verzögerungen beim Übergang von Modellen und Software in die Produktion.
- Einheitliche Toolchain und Workflows: Durch die Einführung einer gemeinsamen Software-Lieferkette arbeiten alle Teams mit einem gemeinsamen Satz an Tools, Workflows und Standards.
Reibungen, die durch unterschiedliche Tools für ähnliche Aufgaben (wie Deployment oder Versionierung) entstehen, werden damit beseitigt.
Wenn Data Scientists und Entwickler dieselben Plattformen für Versionierung, CI/CD und Monitoring verwenden, fällt es ihnen leichter, die Arbeit des jeweils anderen zu verstehen, Prozesse abzustimmen und effektiv zusammenzuarbeiten. - Ende-zu-Ende-Transparenz: Die Integration von DevOps und MLOps verbessert auch die Sichtbarkeit über den gesamten Software- und ML-Lifecycle hinweg.
Alle Beteiligten – von Data Scientists über Entwickler bis zu Ops-Teams – haben Zugriff auf gemeinsame Dashboards, Metriken und Insights zu Modellleistung, Deployment-Status und Systemzustand.
Diese geteilte Transparenz erleichtert die Kommunikation und ermöglicht eine gemeinsame, schnellere Problemlösung. - Effiziente Übergaben und weniger Engpässe: In klassischen Setups ist die Übergabe von ML-Modellen von Data Science an Engineering häufig ein Engpass – bedingt durch unterschiedliche Tools, Prozesse und Erwartungen.
In einer gemeinsamen Software-Lieferkette erfolgt die Übergabe über standardisierte Prozesse, bei denen Modelle als gleichwertige Artefakte behandelt werden.
Sie werden versioniert, getestet und deployed wie regulärer Code – was Verzögerungen und Missverständnisse zwischen Experimentier- und Produktionsphase reduziert. - Geteilte Verantwortung und gemeinsame Ziele: Sind DevOps und MLOps integriert, arbeiten die Teams nicht mehr isoliert, sondern tragen gemeinsam die Verantwortung für den Erfolg der gesamten Pipeline.
Diese geteilte Verantwortung fördert eine gemeinsame Zielausrichtung: schnelle Auslieferung, hohe Systemzuverlässigkeit und kontinuierliche Verbesserung.
Der kulturelle Wandel – weg von isolierten Zuständigkeiten hin zu Shared Ownership – stärkt den Teamzusammenhalt und fördert ein produktiveres, effizienteres Arbeitsumfeld.
Die Zusammenführung von DevOps und MLOps baut Barrieren zwischen Teams ab, fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, reduziert Reibungsverluste und sorgt dafür, dass alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.
Das Ergebnis: effizientere Workflows und qualitativ hochwertigere Software- und ML-Produkte, die sich flexibel an wechselnde Geschäftsanforderungen anpassen lassen.
Technische Integration: Zentrale Komponenten
Nachdem wir die Vorteile der Verschmelzung von MLOps und DevOps betrachtet haben, stellt sich die Frage: Wie lässt sich das technisch umsetzen?
Modellversionierung und Integration in Artifactory
Die Verwaltung von ML-Modellen innerhalb einer einheitlichen Software-Lieferkette bedeutet, sie wie klassische Software-Artefakte zu behandeln. Durch die Integration von ML-Modellen in bestehende Tools zur Artefaktverwaltung – z. B. JFrog Artifactory – gewinnen Unternehmen an Kontrolle, Nachverfolgbarkeit und Konsistenz über den gesamten Software-Lifecycle hinweg.
- Konsistente Versionierung
In der klassischen Softwareentwicklung werden Artefakt-Repositories wie JFrog Artifactory, Nexus oder AWS S3 zur Speicherung, Versionierung und Verwaltung von Binärdateien, Bibliotheken und Abhängigkeiten genutzt.
Wendet man diese Prinzipien auf ML-Modelle an, kann jedes trainierte Modell versioniert und mit bestimmten Codeversionen, Trainingsdaten, Hyperparametern und Konfigurationen verknüpft werden.
So wird nachvollziehbar, welches Modell wann und warum in Produktion ging – eine entscheidende Voraussetzung für Reproduzierbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. - Artefaktspeicherung und -promotion
ML-Modelle lassen sich im selben Artefakt-Repository speichern wie Binärdateien, wodurch eine zentrale und konsistente Speicherung möglich wird.
Data Scientists und Engineers können Modelle – wie klassische Software-Komponenten – durch verschiedene Umgebungen promoten (z. B. Testing → Staging → Produktion).
Die Promotion erfolgt über vordefinierte Qualitäts-Gates, sodass nur Modelle mit bestimmten Performance-Werten (z. B. Genauigkeit, Robustheit) freigegeben werden – kontrolliert, nachvollziehbar und auditierbar. - Abhängigkeitsmanagement
Wie Softwarekomponenten von bestimmten Bibliotheken oder Frameworks abhängen, benötigen ML-Modelle oft spezifische Datenquellen, Feature Stores oder Laufzeitumgebungen.
Die Einbindung in ein Artefaktmanagement-System erlaubt es, alle Abhängigkeiten mit dem Modell zu versionieren und zu dokumentieren. Das erleichtert die Reproduzierbarkeit, da bei Bedarf der gesamte Zustand wiederhergestellt werden kann – inklusive Daten, Konfiguration und Laufzeit. - Nachverfolgbarkeit und Auditierbarkeit
Werden Modelle wie Software-Artefakte behandelt und gemeinsam verwaltet, entsteht ein lückenlos nachvollziehbares System.
Versionierung und Protokollierung ermöglichen es Teams, jederzeit zu sehen, welches Modell mit welchen Daten, Parametern und Codeständen trainiert und deployed wurde.
Diese Nachverfolgbarkeit ist essentiell für Debugging, Performance-Analysen und Compliance-Anforderungen – und liefert den vollständigen Audit-Trail für jedes Modell-Artefakt.
Gemeinsame CI/CD-Pipelines
Die Erweiterung bestehender CI/CD-Workflows um ML-spezifische Aufgaben ist ein zentraler Bestandteil der Integration von MLOps und DevOps. Eine gemeinsame CI/CD-Pipeline stellt sicher, dass Software-Updates und ML-Modelle gemeinsam entwickelt, validiert und bereitgestellt werden – für eine nahtlose und effiziente End-to-End-Delivery.
- Erweiterung des CI-Prozesses um ML-Modelle: In einer einheitlichen Pipeline wird der CI-Prozess um ML-spezifische Aufgaben wie Datenvalidierung, Feature Engineering und Modelltraining ergänzt. Bei neuen Daten oder relevanten Codeänderungen kann die CI-Pipeline automatisch ein Modelltraining auslösen. So werden Modelle kontinuierlich aktualisiert und auf dem neuesten Datenstand trainiert – und liefern stets aktuelle Erkenntnisse und Prognosen. Automatisiertes Testen ist dabei unerlässlich: Modelle können gegen vordefinierte Benchmarks validiert werden, um sicherzustellen, dass sie die Mindestanforderungen erfüllen, bevor sie in den nächsten Pipeline-Schritt übergehen.
- Automatisierte Modellvalidierung und Qualitätssicherung: Die QA-Phase klassischer CI/CD-Pipelines testet Funktion und Performance von Softwarekomponenten. In einer gemeinsamen Pipeline wird diese Phase um Modellvalidierung erweitert:
Dazu gehören Performance-Tests auf Holdout-Datensätzen, statistische Prüfungen auf Bias oder Drift sowie das Erfüllen definierter Metriken wie Genauigkeit, Präzision oder Recall.
Durch die Automatisierung dieser Schritte werden manuelle Eingriffe minimiert und eine einheitliche Bewertungsgrundlage für Modelle geschaffen. - Deployment im Rahmen von CD: Im CD-Schritt werden Modelle wie Software-Artefakte behandelt. Sobald ein Modell alle Validierungsstufen bestanden hat, wird es automatisch containerisiert und in die Zielumgebung deployed – z. B. in einen Kubernetes-Cluster, einen Model-Serving-Dienst wie TensorFlow Serving oder direkt in den Anwendungskontext. In einer gemeinsamen Pipeline werden Anwendungscode und Modell gleichzeitig ausgeliefert, was die Kompatibilität erhöht und das Risiko von Versionskonflikten reduziert.
- Retraining und Modellaktualisierung: Ein zentrales Merkmal von ML-Systemen ist der Bedarf an regelmäßigem Retraining, um auf sich ändernde Daten zu reagieren.
Eine gemeinsame CI/CD-Pipeline ermöglicht die Automatisierung von Retraining-Workflows. Bei erkannten Data-Drift kann automatisch ein neuer Trainingslauf gestartet, validiert und das Modell neu bereitgestellt werden – alles innerhalb desselben automatisierten Workflows wie für traditionelle Software. - Blue-Green- und Canary-Deployments für Modelle: Strategien wie Blue-Green- oder Canary-Deployments sind in DevOps weit verbreitet – und lassen sich auch auf ML-Modelle anwenden. So können neue Modellversionen schrittweise eingeführt und in Produktionsumgebungen getestet werden, während wichtige KPIs überwacht werden. Treten Probleme auf, lässt sich das Deployment schnell zurückrollen, um Nutzerbeeinträchtigungen zu minimieren. Mit diesen Strategien können Teams neue Modelle risikominimiert und kontrolliert ausliefern.
- Monitoring und Feedback-Loops: Nach dem Deployment müssen sowohl Code als auch Modelle auf Performance und Stabilität überwacht werden.
Gemeinsame CI/CD-Pipelines ermöglichen zentralisierte Monitoring-Tools, die die Gesundheit von Softwarekomponenten und ML-Modellen überwachen. Dieses integrierte Monitoring liefert kontinuierliches Feedback – z. B. bei abnehmender Modellgenauigkeit oder Out-of-Distribution-Daten – und kann automatisiert weitere Pipeline-Aktivitäten auslösen wie Retraining oder Neukalibrierung.
Fazit
Indem ML-Modelle wie Artefakte behandelt und in eine gemeinsame CI/CD-Pipeline integriert werden, erreichen Unternehmen mehr Konsistenz, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit im Delivery-Prozess. Modellversionierung und Artefaktmanagement sorgen dafür, dass alle Komponenten – Code, Binärdateien und Modelle – mit derselben Sorgfalt verwaltet werden: inklusive Nachverfolgbarkeit, Audit-Trails und standardisierten Promotions.
Gemeinsame CI/CD-Pipelines bringen ML-spezifische Aufgaben wie Training, Validierung und Retraining in den automatisierten Delivery-Zyklus – so werden Software und Modelle kontinuierlich und friktionsfrei integriert und deployed.
Dieser integrierte Ansatz reduziert Redundanz und manuelle Eingriffe und versetzt Teams in die Lage, hochwertige Software und ML-Modelle schnell, zuverlässig und skalierbar bereitzustellen – mit einer nahtlos funktionierenden Software Supply Chain.
Weitere Informationen zu konkreten Herausforderungen bei der Umsetzung und Best Practices zur Optimierung finden Sie im dritten und letzten Teil dieser Blogserie.